
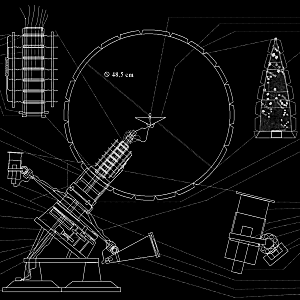
Der Projektor...
Die Kugel aus durchstochener Pappe ist das wichtigste Bauteil des Sternenprojektors.
Ein fertiger Bastelbogen z.B. der von Astromedia ist nicht geeignet, da hier
zwar eine Halbkugel entsteht auf der aber auch Sterne über den Himmelsäquator hinweg abgebildet sind (verzerrungsarme Darstellung steht drauf).Also doch einen Bastelbogen selber konstruieren. Als Ausgangsmaterial diente eine Sternenkarte aus dem Schulatlas. Die ist aber flach und daraus lässt sich keine Kugel zusammen bauen. Die Karte lässt sich in tortenstückförmige Teile schneiden. Für die Kugel aber benötigt man aber eher Pappstreifen in Form von Apfelsinenschalen. Zur Berechnung dieser hat sich folgende Tabellenkalkulation bewährt: Kugelberechnung.xls oder Kugelberechnung.ods . Wenn man die roten Zahlen ändert, kann man so beliebige Kugelsegmente berechnen.
Die "Tortenstücke" kann man dann mit Hilfe eines Morphprogramms in "Apfelsinenschalen" verwandeln. Das Ergebnis für die Nord- und Südhalbkugel ist auch nicht ganz verzerrungsfrei, aber die Sterne befinden sich so ziemlich an der richtigen Position. Planetariumsprojektor_24_SEG.pdf
Das Schöne an der Atlaskarte ist, dass die Helligkeiten der Sterne in 5 Ketegorien angegeben sind. Je mehr Zacken ein Stern hat, um so heller ist er. Dies war sehr praktisch beim Durchlöchern mit unterschiedlichen Nadelstärken.
Das Löcherstechen macht man am besten vor dem Zusammenkleben :-)
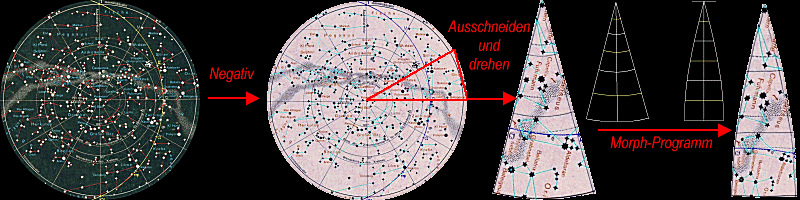

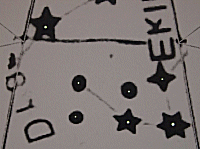
Die insgesamt 24 Kugelsegmente wurden auf
einseitig schwarze Kartonpappe kopiert, wie beschrieben durchlöchert und
anschließend zu zwei Halbkugeln zusammen geklebt. Hierbei haben sich
Wäscheklammern als sehr hilfreich erwiesen. Die beiden Halbkugeln wurden
jedoch nicht zur Gesamtkugel verklebt, sondern für spätere
Wartungszwecke mit 24 Papierklemmen zusammengefügt. 
Am
Südpol wurde ein Loch eingeschnitten, um eine leere Klebebandrolle
einzukleben. Diese sollte in der gleichen Ebene wie der Äquator
eingepasst werden, da die ganze Kugel sonst eiern würde. Eine Wasserwaage
leistete hier gute Dienste. Später stellte sich diese Verklebung als
Schwachstelle heraus und wurde mit Unmengen an Heißklebstoff
stabilisiert.
Lagerung und Antrieb. Die Kugel und die Zusatzprojektoren sollten drehbar gelagert werden und gleichzeitig sollte eine Stromversorgung für alle beweglichen Teile gewährleistet sein.
Fast passgenau in die oben erwähnte leere Klebefilmrolle passt ein Kunststoffabwasserrohr, welches dann zum stehenden Teil des Projektors gehört. Da die Papprolle durch Öl oder ähnliches aufquellen würde und noch ein wenig Platz war befindet sich noch eine Overhead-Folie zwischen Rohr und Papprolle. Die Folie nicht angeklebt sondern dient als Gleithilfe.
Als Antrieb für die Klebefilmrolle der Kugel dient eine zweite Klebefilmrolle, die über einen Zahnriemen angetrieben wird. Klingt einfach, ist es aber nicht!!!
Damit der Zahnriemen auf der Papprolle greift, wurde mit Heißklebstoff ein Abdruck des Zahnriemens auf der Rolle erstellt (mehrfach wieder abgekratzt und erneut ausprobiert...) Jedes Mal wenn man glaubte es funktioniert wurden Zähne übersprungen, es hakte oder blieb stehen. Auch eine Reihe von aufgeklebten Streichhölzern, wie auch ein zweiter umgekrempelter Zahnriemen (geht gar nicht!) führte nicht zum gewünschten Ergebnis.
Aufgeklebte Pappstücke gewährleisten, dass die Kugel sich mitdreht. Eingeklebte Neodymmagneten dienen als Befestigung. Somit kann die Kugel bei Bedarf für Wartungszwecke abgenommen werden.
Eine Eisschachtel aus Kunststoff dient als Gehäuse für das Getriebe. Dieses besteht wiederum aus Bauteilen eines Metallbaukastens.
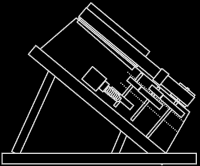
Bei der Lampe, die in der Mitte der Pappkugel angebracht ist, handelt es sich um eine mini-MAGLITE-Xenon-Glühlampe, die mit zwei AA-Akkus betrieben wird.
Zunächst haben wir mit 12V / 20 - 50 W Halogen-Glühlampen experimentiert. Die sind zwar hell aber lieferten kein vernünftiges Bild (bzw. kein Bild!). Das liegt daran, dass die Glühwendel zu groß und der Glaskolben oben eine Art "Nase" besitzt.
Die MAGLITE-Lampe besitzt eine extrem kleine Glühwendel, so dass man schon fast von einer punktförmigen Lichtquelle sprechen kann. Es ist erstaunlich, dass eine so kleine Glühlampe ausreichend Licht liefert. Tatsächlich benötigt man für eine gute Projektion absolute Dunkelheit.
Der Schleifkontakt.
Um die Stromversorgung und die Steuerung der beweglichen Teile
(Sternbildprojektor und Sonnenprojektor) zu gewährleisten ist eine
drehbare Stromabnahme notwendig. Auch dies ist etwas knifflig...
Der erste
(gescheiterte) Versuch bestand ausMessingunterlegscheiben:
Wie
man schon im Bild erkennen kann, gab es immer wieder
Kontaktschwierigkeiten da die Unterlegscheiben nicht ganz exakt in der
gleichen Ebene eingeklebt wurden.
Der zweite gut funktionierende Schleifkontakt
besteht aus Kupferfolie, Papier, Kupferdraht und zwei Einwegspritzen.
Hierzu wurden sieben Löcher spiralförmig in die äußere etwas größere
Spritze geschmolzen (Zange, Nagel, Kerze...). An diesen Stellen wurden
Kupferfolienstreifen um die Spritze herum geklebt (Sekundenkleber) und der
restliche Abschnitt innerhalb der Spritze nach oben geführt. Das Ganze
wurde dann mit Moosgummi und einer kleineren Spritze innen fixiert.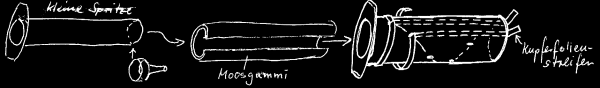
Die Stromversorgung und die Steuerung erfolgt über in eine Holzkiste eingebaute Schalter und Batteriekästen