Ein Planetarium selber bauen – Der zweite Anlauf
Die Ansprüche an den neuen Planetariumsprojektor
Die Lichtquelle für den Sternprojektor
Die etwas ungewöhnliche Aufhängung des Projektors
Das neue Planetarium sollte größer und vielseitiger werden. Der erste Planetariumsprojektor
(2011)
ist in der Lage den Sternenhimmel zu
unterschiedlichen Jahreszeiten darzustellen, zudem können die
wichtigsten Sternbilder der nördlichen Hemisphäre mit Laserprojektoren
angezeigt werden. Ein Handlaserprojektor dient als Ergänzung, um die
Sternbilder des Tierkreises zu verdeutlichen. Der Sonnenprojektor kann
manuell positioniert werden.
Es zeigten sich aber auch die Grenzen im Unterrichtseinsatz. Der
Projektor kann nur den nördlichen Sternenhimmel darstellen, die Position
ist auf den 52. Breitengrad (Hannover) eingestellt und kann nicht
verändert werden, die Anzahl der ansteuerbaren Sternbildprojektoren ist
auf 10 begrenzt und es bedarf etwas Geschick und astronomisches Wissen
dazu den Projektor zu bedienen und gleichzeitig einen Vortrag vor einer
Schülergruppe zu halten. Letzteres führte dazu, dass nur einige wenige
Lehrkräfte bzw. Schüler das Planetarium bedienen konnten und somit immer
Terminabsprachen notwendig wurden. Außerdem überlegten wir die
Lichtstärke zu erhöhen.
 Abriss des alten Planetariums
Abriss des alten Planetariums
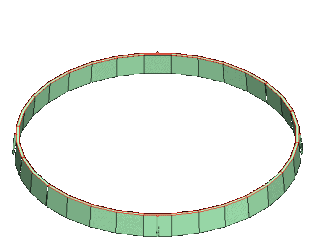
Entwurf
für die neue Kuppel
Die Ansprüche an den neuen Planetariumsprojektor
Das neue Planetarium sollte also diese Mängel ausgleichen. Es
sollte mehr Standorte auf der Erde simulieren können, somit muss der
Sternprojektor nicht nur drehbar, sondern auch in der Neigung
veränderbar sein. Die Anzahl der anzuzeigenden Sternbilder sollte
vergrößert werden, mit einem schwenkbaren Videobeamer wäre somit eine
unendliche Menge an zusätzlichem Bildmaterial realisierbar (Mond-,
Planetenbahnen, Sternschnuppen und nicht zuletzt explodierende
Meteroiten). Und das wichtigste, er sollte selbsterklärend zu steuern
sein, sodass die Bedienung nicht nur durch wenige Personen durchgeführt
werden kann. Entsprechend sollte es eine
programmierbare Computersteuerung unter Verwendung von Schrittmotoren
und Servos werden.

Der Sternprojektor
Wir haben uns wie beim ersten Projektor wieder für eine
Lochprojektion entschieden. Statt Pappe verwenden wir dicke
Aluminiumfolie (Saunabaubedarf). Der Vorteil besteht darin, dass die
eingestochenen Löcher exakt kreisförmig sind und nicht ausfransen, wie
dies bei Pappe als Material zum Teil passierte. Wir konnten also die
Sternkarte und die Nadeln von 2011 verwenden. Die Sternkarten haben wir
dann unter dem Abzug mit Pinselreiniger von den Ausdrucken (Kopierer! -
Tintenstrahldrucker geht nicht) auf die Aluminiumfolie übertragen. Für
den Ausschnitt kam eine selbstgebaute Falz- und Schnittschablone zum
Einsatz, die Einzelteile wurden gestochen, zur Kugel verklebt und innen
schwarz gespritzt. Zur Aufnahme wurden Kunststoffwinkelprofile mittels
einer Holzform exakt gebogen (Haarfön) und die Alukugel mit
Papierklemmen befestigt.









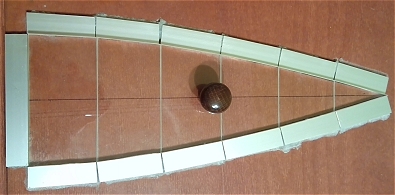



Die Lichtquelle für den Sternprojektor
Während bisher als nahezu punktförmige Lichtquelle eine
mini-MAGLITE-Xenon-Glühlampe zum Einsatz kam, standen jetzt superhelle
LEDs zur Verfügung. Diese haben allerdings einen Abstrahlwinkel von
weniger als die benötigten 180° und die Lichtstärke nimmt zum Rand hin
ab. Schließlich kam die Idee auf eine
superhelle LED schnell rotieren zu lassen. Einige Bauteile haben wir in
3D-Druck realisiert. Der Rotor ist gleichzeitig ein Miniaturlüfter, der
für die Kühlung des Leuchtmittels sorgt, zwei Kugellager dienen zur
Stromversorgung. Das Ergebnis war recht gut, allerdings haben wir die
Stromversorgung für den Elektromotor und die Lampe parallel geschaltet,
sodass Helligkeit und Rotationsgeschwindigkeit gekoppelt waren.
Interessanterweise nahm die Helligkeit mit der Rotationsgeschwindigkeit
ab, offenbar weil der Widerstand des Elektromotors bei höherer Drehzahl
abnimmt und die Lampe fast kurzschließt. Zwei unabhängig voneinander
regelbare Stromversorgungen sollten das Problem lösen...
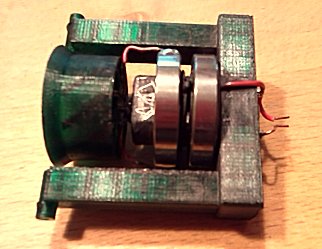

 5W LED links, mini-MAGLITE- Xenon-Glühlampe rechts
5W LED links, mini-MAGLITE- Xenon-Glühlampe rechts  Projektion
bei gedämpften Tageseslicht
Projektion
bei gedämpften Tageseslicht
Die etwas ungewöhnliche Aufhängung des Projektors
Die Konstruktion besteht aus drei Rotationsebenen, wobei die dritte
davon um 23,5° (Ekliptik) zu den anderen zweien geneigt ist und zur
Aufnahme des Sonnenprojektors dient. Die anderen nehmen den
Sternprojektor bzw. den Videobeamer auf. Als Antrieb dienen zwei
arduinogesteuerte Schrittmotoren bzw. ein digitaler Servo für den
Sonnenprojektor. Die Sonnenprojektorebene ist mit der
Sternprojektorebene gekoppelt, sodass eine genaue Sonnenpositionierung
ermöglicht wird.
Das Ganze ist auf einem kugelgelagerten Wagen montiert, der auf einer
teilkreisförmigen Aluminiumschiene auf- und abfahren kann. Ein
Akkuschraubermotor bewegt diesen Wagen an einer gebogenen Gewindestange
(wieder mal eine gute, wenn auch recht unkonventionelle Schüleridee).
Endschalter verhindern einen zu erwartenden Totalschaden, falls sich der
Motor über die vorgesehenen Grenzen hinaus schrauben würde.
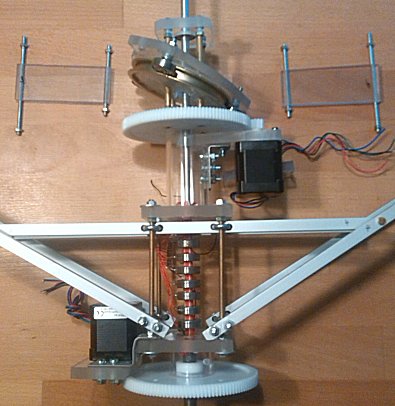
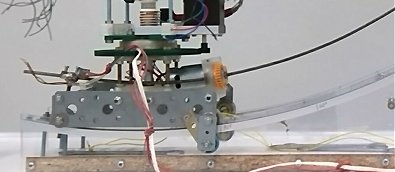
Schleifkontakt
Wie immer knifflig und auch leider störanfällig sind die
Schleifkontakte. Die einzelnen Ebenen müssen natürlich mit Strom
versorgt werden bzw. eine Steuerung zulassen. Um nicht zu viele
Steuerleitungen mit Schleifkontakten verbinden zu müssen, haben wird den
Arduino auf der mittleren Viedeobeamer-Rotationsebene montiert. Die
Schrittmotoren, die sich auf der selben Ebene befinden, kommen somit
ohne Schleifkontakte aus. Dafür wird die Programmierung für die
Ansteuerung etwas komplizierter, da die Bewegung eines Schrittmotors im
anderen kompensiert werden muss. Der Arduino selbst nimmt die Befehle
über ein Infrarotauge von einer alten Fernseherfernbedienung entgegen.
Die Neigung wird noch manuell mit Auf- und Abtastern vorgenommen. werden.
Als Schleifkontakte haben zunächst Kugellager gute Dienste
geleistet. Hierzu wurden die Kugellager in Pinselreiniger und Aceton
entfettet und im Anschluss in Kontaktspray gebadet.
Um eine Edelstahlstange wurden die Drähte angeordnet, die
vorbehandelten
Kugellager aufgesteckt, ein Kabel gekappt, abisoliert und mit
einer
Pinzette zwischen die Innenwand des Lagers und die Drähte
gesteckt. Das
restliche Kabel verbleibt ohne Leitungsfunktion als einer der
Abstandshalter zur Stahlstange. Dann wird das nächste Kugellager
aufgesteckt. Da sich diese Kugellager nicht löten ließen wurde
außen
eine Schlaufe gelegt, verdrillt und dann gelötet. Insgesamt
funktionierte
das sehr gut, leider war die Konstruktion etwas
wartungsunfreundlich.
Daher haben wir uns einen etwas platzsparenderen leichter zu
montierenden
Schleifkontakt ausgedacht. Hier werden dann auch schon die Grenzen
unseres
3D-Druckers sichtbar. Diese Stecklösung war leicht zu montieren
und kann
bei bedarf einfach abgenommen werden.
weiterhin kamen versilberter Kupferdraht und Lötkontakte für ICs zum
Einsatz.
Letztlich war aber auch diese Konstruktion noch zu groß und wich dann
einem komplett selbstgebauten Schleifkontakt mit außenliegenden
Kupfeblechstreifen und 3D-Druckteilen.








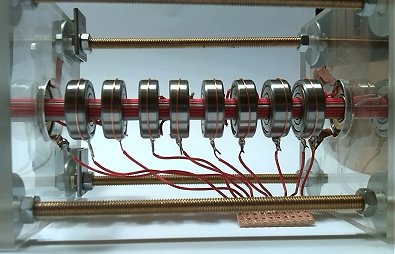 Kugellagerschleifkontakt
Kugellagerschleifkontakt







Kugellagerschleifkontakt mit Presshülsen aus 3D-Druck-Material
Die Kuppel
Die Kuppel sollte nun einen Durchmesser von 5m statt der bisherigen 4m haben. Hier haben wir uns für eine glasfaserbeschichtete Styroporkonstruktion entschieden. Die handelsüblichen 50mm Styroporplatten wurden anhand von Pappschablonen
zu 324 Trapezen
geschnitten,
jeweils 12, 16 bzw. 72 davon wiederum zu größeren Einheiten
verklebt.
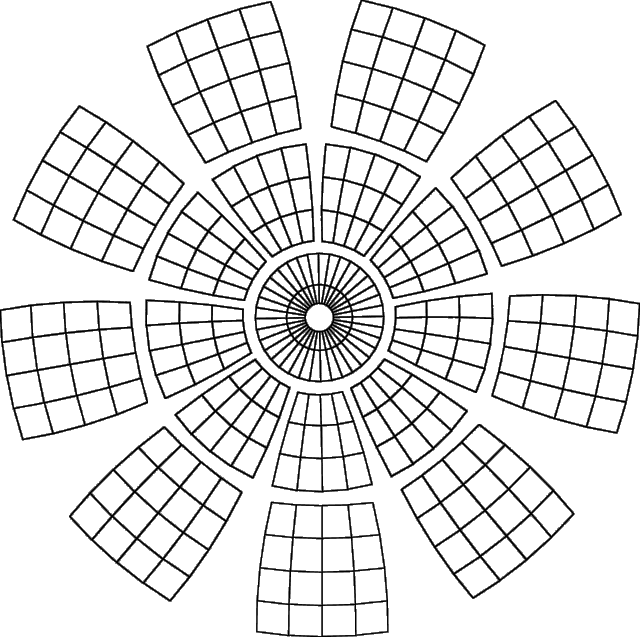
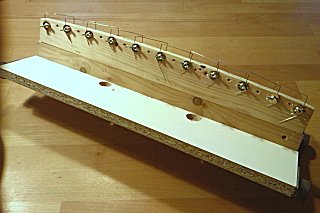


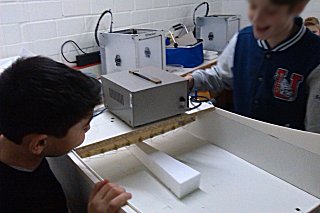
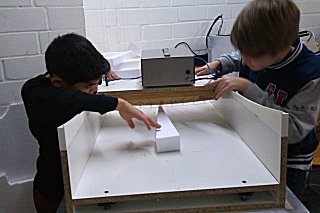
 Vor dem Verkleben wurde jede Platte mit einem
Hohlschnitt versehen
Vor dem Verkleben wurde jede Platte mit einem
Hohlschnitt versehen


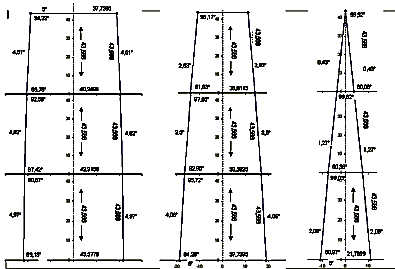 Maße für die Kuppelsegmente Kuppel_Plan.pdf
Maße für die Kuppelsegmente Kuppel_Plan.pdf

 Verklebung mit Glasfasermatten
Verklebung mit Glasfasermatten 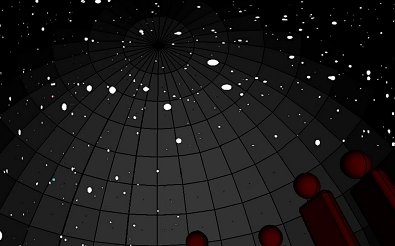 Bisher noch nicht fertig verklebt...
Bisher noch nicht fertig verklebt...

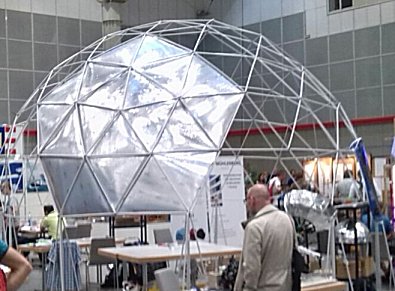
Fazit
Da wir uns zwischenzeitlich einen 3D-Drucker anschaffen konnten, haben wir immer mehr Bauteile damit realisiert und letztlich überlegt, ob man nicht einen Projektor komplett aus dem 3D-Drucker bauen kann. Der Weiterbau an diesem zweiten Projektor wurde letztlich zu Gunsten einer dritten Version aufgegeben, die dann 2017 voll funktionsfähig fertig gestellt wurde.